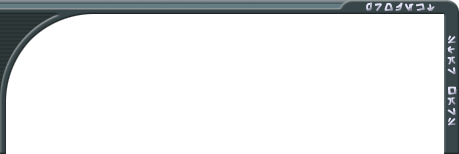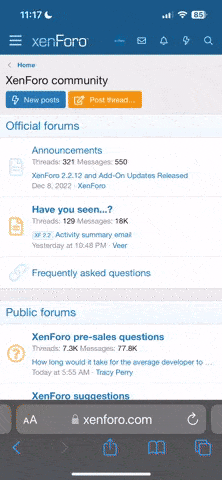Über den Zufall unserer Existenz hat Richard Dawkins in seinem Buch "Der entzauberte Regenbogen" ein paar schöne Zeilen geschrieben:
„Wir alle müssen sterben, das heißt, wir haben Glück gehabt. Die meisten Menschen sterben nie, weil sie nie geboren werden. Die Männer und Frauen, die es rein theoretisch an meiner Statt geben könnte und die in Wirklichkeit nie das Licht der Welt erblicken werden, sind zahlreicher als die Sandkörner in der Sahara. Und unter diesen ungeborenen Geistwesen sind mit Sicherheit größere Dichter als Keats, größere Wissenschaftler als Newton. Das wissen wir, weil die Menge an Menschen, die aus unserer DNA entstehen könnten, bei weitem größer ist als die Menge der tatsächlichen Menschen. Und entgegen dieser gewaltigen Wahrscheinlichkeit gibt es gerade Sie und mich in all unserer Gewöhnlichkeit.
Moralphilosophen und Theologen messen dem Augenblick der Empfängnis großes Gewicht bei: Er ist in ihren Augen der Zeitpunkt, ab dem die Seele zu existieren beginnt. Und auch wer sich wie ich durch solch eine Meinung nicht rühren lässt, muss einen bestimmten Moment neun Monate vor der Geburt als das entscheidendste Ereignis seines persönlichen Schicksals betrachten. Es ist der Augenblick, in dem unser Bewusstsein plötzlich billionenmal genauer vorhersehbar wird als noch einen Sekundenbruchteil zuvor. Sicher, der embryonale Mensch, der nun existiert, hat noch viele Hürden zu überwinden. Die meisten Befruchtungsprodukte enden in einer frühen Fehlgeburt, bevor die Mutter überhaupt davon weiß, und wir alle haben Glück gehabt, dass es uns nicht so ergangen ist. Außerdem besteht die persönliche Identität nicht nur aus Genen. Dennoch war der Moment, in dem eine bestimmte Samenzelle in eine bestimmte Eizelle eingedrungen ist, in unserem persönlichen Rückblick von Schwindel erregender Einzigartigkeit. Damals verschob sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir zu einem Menschen wurden, von Astronomischen in den einstelligen Bereich.
Begonnen hat die Lotterie schon vor der Empfängnis. Unsere Eltern mussten sich kennen lernen, und ihre Empfängnis war ebenso unwahrscheinlich wie unsere eigene. Und so weiter rückwärts in die Vergangenheit über unsere vier Großeltern und acht Urgroßeltern bis in eine Zeit, an die wir nicht einmal denken mögen. Desmond Morris beginnt seine Autobiographie „Mein Leben mit Tieren (1981)“ in seinem charakteristischen, fesselnden Tonfall so:
„Mit Napoleon hat alles angefangen. Wenn er nicht gewesen wäre, säße ich jetzt wahrscheinlich nicht hier, um dieses Buch zu schreiben... eine seiner Kanonenkugeln, abgefeuert im Spanischen Krieg von 1808 – 1814, hat meinem Großvater James Morris einen Arm weggerissen und dadurch der Geschichte meiner Familie eine ganz andere Richtung gegeben.“
Dann berichtet Morris, wie der erzwungene Knick in der Berufslaufbahn seines Ahnen verschiedene Schneeballeffekte hatte, die schließlich in seinem eigenen Interesse für Naturgeschichte ihren Höhepunkt fanden. Aber eigentlich hätte Desmond nicht so vorsichtig sein müssen. An der Geschichte ist kein „wahrscheinlich“. Natürlich verdankt der Napoleon schon sein Dasein als solches. Napoleon brauchte James Morris nicht in den Arm zu schießen, um das Schicksal des kleinen Desmond – aber auch meines und Ihres - zu besiegeln. Nicht mit Napoleon, sondern auch der kleinste mittelalterliche Bauer brauchte nur zu niesen, um irgendetwas zu beeinflussen, das etwas anderes veränderte, das nach einer langen Kettenreaktion schließlich dazu führte, dass einer meiner potentiellen Vorfahren nicht mein Vorfahre, sondern der eines anderen Menschen wurde. Ich rede hier nicht von der „Chaostheorie“ oder der ebenso modernen „Komplexitätstheorie“, sondern nur von der schichten Statistik der Kausalbeziehungen. Der Faden des historischen Geschehens, an dem unser Dasein hängt, ist erschreckend dünn.
„Verglichen mit der Zeit, die wir nicht kennen, o König, ist unser Leben auf Erden wie der Flug eines Sperlings durch jenen Saal, wo Ihr im Winter mit Euren Heerführern und Dienstmannen sitzt. Der Sperling fliegt zur einen Tür herein und zur anderen hinaus, und solange er drinnen ist, ist er gefeit gegen die Winterstürme; doch diese kurze Ruhepause ist im Nu vorbei; er kehrt zurück in den Winter, aus dem er gekommen, und verschwindet aus Eurer Sicht. Mit dem menschlichen Leben ist es ebenso, und was danach sein wird oder davor war, entzieht sich unserer Kenntnis.“
Beda Venerabilis, A History of the English Church and People (731)
Auch in anderer Hinsicht haben wir Glück gehabt. Das Universum ist über 100 Millionen Jahrhunderte alt. Nach einem vergleichbar langen weiteren Zeitraum wird die Sonne zu einem roten Riesen angewachsenen sein und die Erde verschlingen. Jedes dieser vielen hundert Millionen Jahrhunderte war zu seiner Zeit „das derzeitige Jahrhundert“ oder wird es sein, wenn seine Zeit kommt. Interessanterweise können sich manche Physiker mit der Vorstellung von einer „wandernden Gegenwart“ nicht anfreunden: Sie ist in ihren Augen ein subjektives Phänomen, für das sie in ihren Gleichungen keinen Platz finden. Aber ich argumentiere hier durchaus subjektiv. Für mich – und ich nehme an, auch für andere Menschen – fühlt es sich so an, als ob die Gegenwart aus der Vergangenheit in die Zukunft wandert, wie ein winziger Scheinwerferkegel, der an einem riesigen Zeitlineal entlang kriecht. Hinter dem Lichtkegel liegt alles im Dunkeln, in der Düsternis einer toten Vergangenheit. Und alles vor dem Lichtkegel liegt in der Dunkelheit der unbekannten Zukunft. Die Chance, dass unser Jahrhundert gerade dasjenige ist, auf dem der Scheinwerfer ruht, ist ebenso groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig in die Luft geworfener Pfennig auf eine ganz bestimmte, auf der Straße von New York nach San Francisco krabbelnde Ameise trifft. Mit anderen Worten: Jeder von uns ist mit überwältigender Wahrscheinlichkeit tot.
Trotz dieser schlechten Chancen bemerken wir, dass wir in Wirklichkeit lebendig sind.
Nach einem Schlaf von vielen hundert Millionen Jahrhunderten schlagen wir endlich auf einem Planeten des Überflusses die Augen auf, auf einem Planeten voller leuchtender Farben und überschäumenden Lebens. Und in wenigen Jahrzehnten müssen wir sie wieder schließen. Ist es nicht eine edle, erleuchtete Art, unsere kurze Zeit unter der Sonne zu verbringen, wenn wir zu verstehen streben, was das Universum ist und wie es kommt, dass wir darin erwacht sind? Das ist meine Antwort, wenn ich – erstaunlich oft – gefragt werde, warum ich mir die Mühe mache, morgens aufzustehen. Oder anders herum ausgedruckt: Ist es nicht traurig, wenn man ins Grab sinkt, ohne sich jemals gefragt zu haben, warum man geboren wurde? Wer würde bei einem solchen Gedanken nicht aus dem Bett aufspringen, voller Eifer, mit der Erkundung der Welt fortzufahren und sich zu freuen, dass man dazugehört?"