Als jemand, der mit der „Predator“-Reihe nicht vertraut ist (ich habe den ersten Film vor vielen Jahren mal gesehen, da ist aber nicht wirklich etwas hängen geblieben), fand ich viel Gefallen an „Prey“.
Was zunächst einmal sehr positiv ins Auge sticht, ist die handwerkliche Machart. Der Film setzt in hohem Maße auf natürliche Kulissen, ja er bietet, insbesondere in den ersten Minuten, ein Sammelsurium an wunderschönen Naturaufnahmen. Sehr schön dabei anzusehen ist, dass man sich auch Zeit für langsame und entschleunigte Kamerafahrten und -einstellungen nimmt, in die man als Zuschauer eintauchen und die Atmosphäre genießen kann.
Durchbrochen wird das Naturschauspiel, selbstverständlich und sicherlich beabsichtigt, immer wieder durch die Angriffe des Predator, welche sehr brutal ausfallen und damit in Widerspruch zu den beruhigenden und schönen Naturaufnahmen stehen. Meines Erachtens nach offenbart der Film durch dieses Element eine tiefere Erzählebene: Natürlich ist „Prey“ auch ein Film, der Unterhaltungswert bietet, aber es wird früh deutlich, dass er erzählerisch auch höhere Ansprüche verfolgt. So lassen sich die martialischen Kampf- und Mordszenen mit dem Predator, welcher hier in die indigene Welt des Amerika des 18. Jahrhunderts eindringt, zweifellos als Kommentar auf den Eingriff des Menschen in die Natur, letztlich aber auch in das Leben der amerikanischen Ureinwohner in vergangenen Jahrhunderten und die mit diesen Angriffen einhergehende Unruhe verstehen.
Wenn es um erzählerische Absichten geht, ist festzuhalten, dass auch eine starke feministische Botschaft bei „Prey“ mitschwingt. Die Protagonistin Naru wird von ihren männlichen Stammesangehören der Comanchen kleingehalten, welche ihr vermitteln, dass sie für Tätigkeiten wie die Jagd und den Kampf eigentlich nicht geeignet sei. Der Gegensatz zwischen Mann und Frau wird nie explizit erwähnt, präsentiert sich aber dennoch in einer Deutlichkeit, welche es schafft, gesellschaftskritische Relevanz zu entfalten, ohne sich explizit in den Vordergrund zu spielen. Anders als bei vielen modernen Produktionen mit weiblichen Hauptfiguren, handelt es sich bei Naru (das sehr gute Schauspiel Amber Midthunders sei dabei erwähnt) auch um eine wirklich erinnerungswürdige und starke weibliche Protagonistin. Sie ist keineswegs von Anfang an übermächtig, sondern fällt im Gegenteil gerade zu Beginn oftmals auf die Nase und muss sich ihre Fähigkeiten erst erarbeiten. Wie ihr das im Laufe des Films gelingt, ist umso beeindruckender.
Seine kleineren Schwächen hat „Prey“ am Ende durchaus: Nicht jeder CGI-Effekt ist ganz treffsicher, und auch so mancher brutaler Kill dient eher dem Showeffekt, als dass er wirklich Sinn ergäbe. Dennoch handelt es sich insgesamt um einen sehr sehenswerten Film, der sich nicht zuletzt aufgrund seiner Bildgewalt sicher auch auf der großen Kinoleinwand gut gemacht hätte und bei dem sich aufregende Szenen und ruhige, durchaus zum Nachdenken anregende Momente die Klinke in die Hand geben.



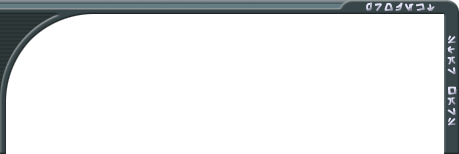
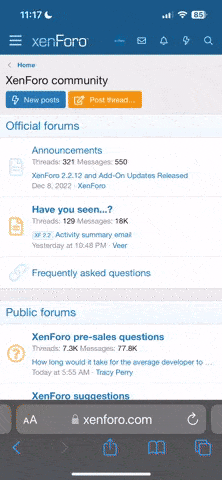
 Jedenfalls verspürte ich nach dem Film sofort den Drang, mich ein bisschen eingehender mit dieser Alien Spezies auseinanderzusetzen zu müssen ^^
Jedenfalls verspürte ich nach dem Film sofort den Drang, mich ein bisschen eingehender mit dieser Alien Spezies auseinanderzusetzen zu müssen ^^