Wie wird dies denn definiert ?
Der NATO-Rat in Brüssel trifft schlussendlich die Entscheidung. Für den Bündnisfall sind bestimmte Territorien relevant, andere nicht (oder müssten erst dazu deklariert werden).
Ich zitiere:
Fragen wirft insoweit die Bündnisklausel des NATO-Vertrags auf, die das gegenseitige Einstehen der Bündnispartner im Falle eines bewaffneten Angriffs auf einen Bündnispartner vorsieht. Art. 5 NATO-Vertrag lautet: „Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen wird (…)“
Anders als die kollektive Selbstverteidigungsklausel in Art. 51 UN-Charta ist die Bündnisklausel des NATO-Vertrages vom 4. August 1949 geographisch begrenzt.
Der NATO (=Nordatlantik)-Vertrag deutet bereits mit seinem Namen auf seine territoriale Anwendbarkeit hin. Art. 6 NATO-Vertrag umschreibt das NATO-Vertragsgebiet und regelt damit die geographische Reichweite (d.h. den Anwendungsbereich ratione loci) der Bündnisverpflichtungen:
„Im Sinne des Artikels 5 gilt als bewaffneter Angriff auf eine oder mehrere der Parteien jeder bewaffnete Angriff …
- auf das Gebiet eines dieser Staaten in Europa oder Nordamerika, auf die algerischen Departements Frankreichs, auf das Gebiet der Türkei oder auf die der Gebietshoheit einer der Parteien unterliegenden Inseln im nordatlantischen Gebiet nördlich des Wendekreises des Krebses;
- auf die Streitkräfte, Schiffe oder Flugzeuge einer der Parteien, wenn sie sich in oder über diesen Gebieten oder irgendeinem anderen europäischen Gebiet, in dem eine der Parteien bei Inkrafttreten des Vertrags eine Besatzung unterhält oder wenn sie sich im Mittelmeer oder im nordatlantischen Gebiet nördlich des Wendekreises des Krebses befinden.“
Daraus ergibt sich der territoriale Anwendungsbereich für den NATO-Bündnisfall: Der NATO-Vertrag wird relevant bei bewaffneten Angriffen gegen einen Bündnispartner in Europa, also etwa nicht im Falle eines Angriffs auf eine britische Überseebesitzung (ehem. Kronkolonien, heute: British Overseas Territories, gelegen vor allem in der Karibik, im Südatlantik und im Pazifik). Der argentinische Angriff auf die britischen Falklandinseln (arg.: Malvinas) im Südatlantik im Frühjahr 1982 fiel nicht in den Wirkungsbereich des NATO-Vertrages und vermochte den Bündnisfall daher nicht auszulösen.
Einen Sonderfall bilden die nicht in Europa gelegenen französischen Überseegebiete (Départements und Régions d’outre-mer, bis zur Verfassungsreform 2003: Territoires d´outre mer), die – als ehemalige Kolonien – seit 1946 zum französischen Staatsgebiet gehören und praktisch den gleichen Status wie die französischen Departements des Festlandes haben. Diese Überseedepartements sind Teil der EU (nicht jedoch des Schengen-Raums); die Bewohner sind französische Staatsbürger, nehmen an den Wahlen teil und führen den Euro als Währung. Für die seit 1946 zu Frankreich gehörenden Überseedepartements wurde bei Abschluss des NATO-Vertrages im Jahre 1949 die Regelung getroffen, dass allein die algerischen Departements Frankreichs in das NATO-Vertragsgebiet (vgl. Art. 6 NATO-Vertrag) einbezogen wurden.7 Da die weiteren (karibischen) Überseedepartements den gleichen Status wie die algerischen Departements hatten, lässt sich bei einer Auslegung von Art. 6 NATO-Vertrag im Umkehrschluss (argumentum e contrario) davon ausgehen, dass die nicht-algerischen Überseedepartements eben gerade nicht zum NATO-Vertragsgebiet dazugehören sollten.
Der NATO-Bündnisfall wird ferner relevant bei bewaffneten Angriffen auf die USA und Kanada in Nordamerika (einschl. Alaska) sowie bei einem Angriff gegen eine im Nordatlantik (nördlich des Wendekreises des Krebses - Breitenkreis bei 23°26′16″ Nord) gelegene Insel, die der Gebietshoheit eines Bündnispartners unterliegt (z.B. die spanischen Kanaren, die portugiesischen Azoren / Madeira, das norwegische Spitzbergen oder die dänischen Faröer-Inseln).
Ein potentieller militärischer Angriff auf die (oben erwähnten) amerikanische Außengebiete im Westpazifik (wie z.B. Insel Guam) würde dagegen den NATO-Bündnisfall nicht auslösen. Das kollektive Selbstverteidigungsrecht aus Art. 51 UN-Charta (also das Recht jedes Staates zur Nothilfe gegenüber einem angegriffenen Staat) bleibt indes unbenommen. Einen Sonderfall bildet schließlich der US-Bundesstaat Hawaii. Anders als die französischen Überseedepartements (die schon bei Vertragsabschluss zu Frankreich gehörten, s.o.) wurde Hawaii erst im August 1959 (also 10 Jahre nach Verabschiedung des NATO-Vertrages) zum 50. US-Bundesstaat erklärt. Vom Wortlaut des Art. 6 NATO-Vertrag fällt die pazifische Inselgruppe, die eben nicht in Nordamerika liegt, nicht in den Wirkungsbereich des Vertrages. Art. 6 NATO spricht sich im Kern für eine territoriale Begrenzung des Vertragsgebiets auf Europa und Nordamerika aus. Diese territoriale Begrenzung liegt im wohlverstandenen politischen Interesse der (europäischen) NATO-Vertragspartner an einer Begrenzung ihrer Bündnisverpflichtungen, insbesondere mit Blick auf eine Verstrickung in potentielle Krisen im asiatisch-pazifischen Raum.
Doch ist fraglich, ob es insoweit dem Geist des NATO-Vertrages entspricht, dass ein Vertragsstaat „Abstriche“ bei seiner territorialen Sicherheit hinnehmen muss, weil er nach Vertragsschluss weitere Gebiete hinzugewonnen hat. Das Prinzip der beweglichen Vertragsgrenzen (Art. 29 WVRK) vermag das strikte Territorialitätsprinzip des Art. 6 NATO-Vertrag aufzuweichen. Art. 29 WVRK hat jedoch dispositiven Charakter – kann also abbedungen werden. Ob Art. 29 WVRK insoweit „Vorrang“ gegenüber Art. 6 NATO-Vertrag genießt, hängt allerdings letztlich vom Willen der Vertragspartner ab. denn gem. Art. 29 WVRK muss eine „abweichende Absicht aus dem Vertrag hervorgehen oder sich anderweitig ergeben“.14 Eine solche Absicht lässt sich jedoch nicht eindeutig ausmachen: Das Beispiel der algerischen Departements Frankreichs in Art. 6 NATO-Vertrag zeigt, dass die Vertragspartner bei Vertragsabschluss zumindest bereit waren, Ausnahmen von der territorialen Begrenzung des Vertragsgebietes auf Europa, den Nordatlantik und Nordamerika zu akzeptierten. Insoweit könnte man mutmaßen, dass es anlässlich des NATO Vertragsabschlusses im Jahre 1949 eine Klarstellung in Art. 6 NATO-Vertrag – analog zur Regelung der algerischen Departements – gegeben hätte, wäre Hawaii bereits damals schon 50. US-Bundesstaat gewesen. Jedoch hat es anlässlich der amerikanischen Proklamation Hawaiis als 50. US-Bundesstaat im Jahre 1959 weder eine offizielle NATO-Erklärung noch ein Protokoll (wie bei den zahlreichen NATO-Beitritten seit 1949) oder eine bloße Zur-Kenntnisnahme seitens des NATO-Rates (wie im Fall der algerischen Departements) gegeben. Ebenso fehlt es an einer entsprechenden Erklärung der USA gegenüber der NATO.
Im Falle eines Angriffs auf Hawaii müsste der NATO-Rat den NATO-Bündnisfall einstimmig beschließen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt würde man dort rechtliche und politische Einigkeit unter den NATO-Staaten herstellen müssen.
 :
:


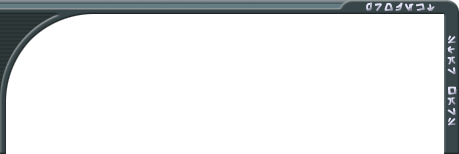
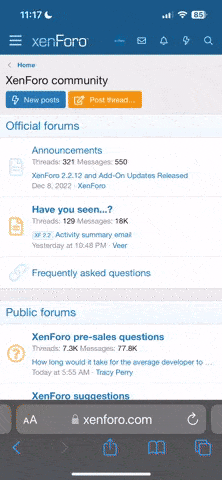

 .
.