Der Schlaf der Phantome - Kritik in DER ZEIT
Mit dem Motto "Nur negative Kritiken sind unterhaltsamme Kritiken" setzen wir unsern Flug über Zeitungsredaktionen im Sommer 1999 fort. Ein Zwischenstopp wird bei "DIE Zeit" eingelegt:
"George Lucas hat in seinem neuen und lang erwarteten Film "The Phantom Menace" nichts zu erzählen. Der weltweite Publikumserfolg von "Star Wars" ist dennoch nicht aufzuhalten
von Andreas Kilb
Als Jennifer S. aus dem Gerichtsgebäude in Springfield/Illinois trat und auf die Kameras zuging, strahlte ihr Gesicht vor Freude. Soeben hatte ihr der Richter drinnen erlaubt, ihren Namen in Obi-Wan Kenobi zu ändern. Zuerst, erzählte Jennifer, sei sie durch ein Gewinnspiel im Radio auf die Idee gekommen. "Am Anfang war es nur ein Witz, aber später fand ich den Namen schön und originell. Jeder kann doch heißen, wie er will!"
Jennifer ist nicht allein in ihrer Begeisterung für Obi-Wan Kenobi und seinesgleichen. Derzeit bereiten sich gut 50 Millionen Amerikaner darauf vor, ab 19. Mai die Kinokassen zu belagern, um Star Wars - Episode One: The Phantom Menace zu sehen, das jüngste Abenteuer aus der Welt Obi-Wans. Allein am Eröffnungstag werden etwa zwei Millionen Angestellte ihre Arbeit im Stich lassen, um in The Phantom Menace zu gehen; der volkswirtschaftliche Schaden wird auf 300 Millionen Dollar geschätzt. Ein gutes Drittel dieser Summe dürfte der Film schon am ersten Wochenende einspielen. Bis Ende 1999 wird The Phantom Menace weltweit voraussichtlich eine Milliarde Dollar in die Kassen bringen und damit hinter Titanic der zweiterfolgreichste Spielfilm aller Zeiten sein.
Doch das ist nur ein kleiner Teil des Geldsegens, der aus dem Star Wars-Himmel auf die Freizeitindustrie herniederregnen wird. Der Spielzeughersteller Hasbro, der die Vermarktungsrechte an den meisten Figuren der Filmserie besitzt, erwartet durch The Phantom Menace zusätzliche Einnahmen von über zwei Milliarden Dollar. Der Ballantine-Verlag hat mit der Buchversion der Filmstory bereits einen Bestseller gelandet. Und der Pepsi-Konzern, zu dem mehrere Fast-food-Ketten gehören, musste 1997 zweieinhalb Milliarden Dollar bezahlen, um Star Wars-Bilder und -Embleme exklusiv auf seine Produkte drucken zu dürfen; entsprechend hoch fallen die Gewinnerwartungen aus.
Ein guter Teil der ungeheuren Summen, die das Phantom Menace-Phänomen in diversen Industriesparten generiert, fließt zurück in die Taschen des Mannes, der den Film geschrieben, produziert und gedreht hat. George Lucas, ein untersetzter, graubärtiger und eigenbrötlerischer Mittfünfziger, ist seit langem der reichste Filmregisseur der Welt. Als Lucas vor 23 Jahren mit der 20th Century Fox den Produktionsvertrag für seinen Film Krieg der Sterne abschloss, sicherte er sich neben der Option auf weitere Folgen der Saga auch die Rechte für alle T-Shirts, Plastikpuppen und Computerspiele, die der Star Wars-Boom in die Welt setzen würde. Dieser Geschäftssinn hat Lucas zum Milliardär gemacht - und seine Phantasie zugleich für alle Zeiten an die Sternenkrieger gekettet.
George Lucas ist der beinahe tragische Fall eines Rebellen, der durch die Gunst der Umstände zum Despoten wird. Bevor er mit Krieg der Sterne (1977) auf Gold stieß, hatte Lucas zu jenem Dutzend jüngerer Filmregisseure um Francis Ford Coppola, Martin Scorsese und Steven Spielberg gehört, das in den siebziger Jahren gegen die Oligarchie der großen Hollywoodstudios aufbegehrte. Lucas' frühe Filme, die düstere Allegorie THX 1138 (1970) und die Kleinstadt-Apokalypse American Graffiti (1973), waren, ebenso wie die von Spielberg, Versuche, ein unverkitschtes, zeitgenössisches Porträt Amerikas zu zeichnen. Aber so wie Spielberg nach E.T. kein Projekt mehr gegen den Willen der Studios verfolgte, wurde auch Lucas zum Sklaven seines Erfolgs. Die Star Wars-Trilogie, deren Fortsetzungen Das Imperium schlägt zurück (1980) und Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983) er von Auftragsregisseuren inszenieren ließ, befreite Lucas von der Willkür Hollywoods, doch sie gab zugleich die Maßstäbe vor, an denen sein Schaffen von nun an gemessen wurde: groß, größer, am größten. George Lucas, der mit einer Science-fiction-Kindergeschichte spekuliert hatte, um endlich ein Zimmer für sich allein zu haben, bekam einen Palast, aus dem er inzwischen den Ausgang nicht mehr findet.
Da geht es ihm wie seinem Helden Luke Skywalker. Von Anfang an war die Versuchung groß, Star Wars als Schlüsselgeschichte zu lesen, die vom Aufstand der jungen Filmemacher, angeführt von Coppola als Yoda, gegen das dunkle Imperium der Studios erzählt. Aber diese Interpretation stillt bloß den kleinen Hunger der Filmkritik. Denn Lucas' Star Wars-Saga ist nur auf den ersten Blick die Chronik einer Rebellion. Hinter dem wolkigen Liberalismus der Rebellenstory verbirgt sich ein viel handfesterer Impuls, der dem Geschehen erst seine Richtung gibt. Es ist die Sehnsucht nach einem abgeschlossenen, sinnerfüllten Universum, nach jener Einheit von erzählter und erlebter Zeit, die in den medial zerstückelten Restwelten unserer heutigen Wirklichkeit verlorenzugehen droht.
Die Geschichte der Star Wars-Galaxie kennt keine schwarzen Löcher und keine Ambivalenz. Zwischen der hellen und der dunklen Seite der Macht ist kein Platz für Graustufen, hier regiert das Prinzip des Alles-oder-Nichts, das den klassischen Epen und Sagen, mit denen Star Wars gern verglichen wird, in Wahrheit sehr fremd ist. Um so vertrauter ist es den Religionen. Dass die Welt im Chaos liegt, dass die Kräfte des Lichts und der Finsternis um die Herrschaft ringen, bleibt von Ahura Masdah und Ahriman bis zu den Hirngespinsten diverser heutiger Sekten ein geläufiges Muster, und über die Jedi-Ritter, die Engel der göttlichen Gerechtigkeit, könnte mancher mittelalterliche Mystiker ein Traktätchen schreiben. Es ist diese Wendung vom Phantastischen ins Religiöse, die Lucas' Epopöe von Science-fiction-Klassikern à la Asimov und Lem unterscheidet, und es ist dieser transzendentale Touch (und Quatsch), der den drei Star Wars-Filmen die kultische Verehrung eingetragen hat, die sie mittlerweile genießen.
Aber am Anfang des Milliardenmärchens stand etwas anderes. Wir wussten nichts vom freudianischen Durcheinander in Das Imperium schlägt zurück oder den galaktischen Weihnachtsfeiern der Rückkehr der Jedi-Ritter, als wir über die imperialen Raumkreuzer staunten, die im ersten Teil der Trilogie über die Leinwand rauschten. Und es war uns auch gleichgültig, ob Luke Skywalker der "Erwählte" war, der "die Macht ins Gleichgewicht" bringen würde, als wir seinen Angriff auf den Todesstern miterlebten - diesen wilden Ritt durch unausdenkliche Räume, deren Wände mit Lichtgeschwindigkeit am Auge vorbeiflogen. Dies war das Science-fiction-Kino, das wir sehen wollten, schnell, krude, mit einem Minimum an ökologischer Korrektheit, ein thrill ride, auf dem mit Laserschwertern gefochten und, falls nötig, mit Fäusten auf den Feind eingedroschen wurde und der Mut eines einzelnen den Tag entschied. Mehr wollte und musste Star Wars nicht sein.
Eine Schlacht um nichts, ein Krawall ohne Anlass
Etwas von dieser Freude am schieren Spiel ist womöglich auch in George Lucas wieder erwacht, als er im Herbst 1996 seine Trilogie zur Wiederaufführung vorbereitete. In der Zwischenzeit hatte er als Produzent zwei der drei Indiana Jones-Filme Spielbergs, eine Indiana Jones-Fernsehserie und ein Projekt seines früheren Mentors Coppola (Tucker, 198

betreut und von seiner Skywalker Ranch im nordkalifornischen San Rafael aus dem stetigen Wachstum seines Imperiums zugeschaut. Bis Anfang der neunziger Jahre war die Fortsetzung von Star Wars bloß eine vage Idee. Im Jahr 1994 begann Lucas, ein Drehbuch zu schreiben, das die Vorgeschichte der Ereignisse in den ersten drei Star Wars-Folgen erzählen sollte, die Geschichte von Luke Skywalkers Vater Anakin, aus dem später der böse Darth Vader wird, und seiner Frau, der Königin Amidala. Aber erst die Wiederbeschäftigung mit den früheren Filmen brachte, so scheint es, Lucas' Imagination in Gang.
Als Ende letzten Jahres feststand, dass Star Wars - Episode One: The Phantom Menace im Mai 1999 ins Kino kommen würde, begann die größte Gratis-Werbekampagne der Filmgeschichte. Nacheinander veröffentlichten sämtliche amerikanischen Magazine, vom billigsten Fanzine bis zum feinen New Yorker, Drehberichte, Schauspielerporträts, Interviews und Aufsätze zum Thema. Der erste Kinotrailer für The Phantom Menace, der im November die Leinwände erreichte, wurde zum Medienereignis. Lucas, der nur handverlesene Besucher in seiner Eremitage empfing, sah sich in Time und der New York Times als "Viktorianer", hingebungsvoll alleinerziehender Vater und Anhänger einer gemäßigten Despotie porträtiert. Seine Entscheidung, The Phantom Menace nicht wie zuletzt Godzilla auf 6000 oder 7000, sondern nur auf 3000 Leinwänden zu starten, sorgte für die nötige Verknappung des Angebots, die allen Massenhysterien vorausgeht. In der zweiten Aprilwoche begannen rüstige Camper, sich vor den Kinokassen in Los Angeles, New York und Chicago niederzulassen, um beim Kartenverkauf im Mai die ersten zu sein. Das Fernsehmagazin Entertainment Tonight brachte einen täglichen Countdown: noch neun Tage, noch acht, noch sieben ...
Die Chancen von The Phantom Menace, dieser kollektiven Selbsthypnose gerecht zu werden, waren von vornherein gering. Es ist schwer, eine Geschichte zu erzählen, deren Ausgang wir schon kennen. Doch selbst das Leben Anakin Skywalkers könnte spannend sein, wenn der Film sich die Mühe machen würde, es zu schil-dern. Aber offenbar hat Lucas sich den Kampf der Mächte um Anakins Seele für die nächste Star Wars-Folge aufgehoben. So ist The Phantom Menace eine Schlacht um nichts geworden, ein Krawall ohne Anlaß. Der Film beginnt mit der Ankunft des jungen Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) und seines Jedi-Meisters Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) auf dem Planeten Naboo, wo sich Königin Amidala (Natalie Portman) verzweifelt gegen die Invasionsarmee der raubgierigen Trade Federation wehrt. Auf dem Weg in die Hauptstadt Naboos, die wie ein hypertrophes Alt-Bombay aussieht, gabeln die beiden Ritter ein froschmäuliges Schlappohrwesen namens Jar Jar Binks auf, das beim Tauchgang im wäßrigen Kern des Planeten für Unterhaltung sorgt. Gute 40 Filmminuten vergehen, in denen man sich fragt, was dies alles mit Jung Anakin zu tun hat, doch dann müssen Obi-Wan, Qui-Gon und Amidala aus Naboo fliehen und auf Tatooine notlanden, einem Wüstenplaneten, der aus Star Wars - dem Original von 1977 - in guter Erinnerung ist.
Hier treffen wir Anakin (Jake Lloyd) als zehnjährigen Knaben und Sklaven des Schrott-händlers Watto, eines echsenhäutigen Libellentapirs, der ebenso wie Freund Binks vollständig digital erzeugt ist. Anakins Mutter (Pernilla August) sieht aus wie eine der tapferen Frühchristinnen aus Quo Vadis, und auch das pod race, das Turbinenrennen, bei dem Anakin den ersten Preis und seine Freiheit gewinnt, erinnert verdächtig an den kavalleristischen Höhepunkt aus Ben Hur, aber immerhin erreicht The Phantom Menace hier einmal jene Durchschlagskraft, die der Film bis dahin immer nur versprochen hat. Doch schon müssen unsere Helden weiter, diesmal zum Zentralplaneten Coruscant, wo sowohl der galaktische Senat als auch der Zentralrat der Jedi- Ritter tagen, zwei eminente Gremien, von denen das Schicksal der Republik ...
Man ahnt den Fortgang. Am Ende des Films ist der Planet Naboo zwar befreit, aber damit nichts gewonnen; Anakin zwar ein Jedi-Lehrling, aber immer noch ein Knabe; und Königin Amidala sieht immer noch so aus, als hätte sie das Zwölfheiligenöl getrunken, das es für 2,75 Dollar in der Million Dollar Pharmacy in Los Angeles zu kaufen gibt. Das Bankett, mit dem The Phantom Menace ausklingt, deutet immerhin an, wer das Phantom sein könnte, das der Filmtitel ankündigt, aber da läuft auch schon der Abspann. Es ist ein Brot aus Krümeln, das hier gebacken wird, ein Menü aus lauter Vorspeisen.
Die Computertechnik des Films entspricht den Erwartungen - und der Botschaft des Propheten Lucas, der in einem Beitrag für Cinema getönt hat, durch die digitalen Tricks könne er sich auf Dauer von den Zumutungen der Arbeit mit realen Schauspielern befreien. Aber gerade The Phantom Menace, in dem so gut wie keine unbearbeitete Einstellung mehr vorkommt, zeigt offen die Schwäche des technischen Zaubers. Das Digitale ist Beiwerk, nicht Substanz. Es kann eine tote Geschichte nicht animieren. So bleibt Lucas' Film das Phantom, das er schon vor seinem Kinostart war.
Der Erfolg von The Phantom Menace ist dennoch nicht aufzuhalten. Denn bei Star Wars geht es längst nicht mehr um den einzelnen Film, es geht um die Teilnahme an einem Kult, der das Versprechen der Sinnstiftung mit den Zerstreuungen der Unterhaltungsindustrie verbindet. Je größer das Ereignis ist, das die Popkultur gebiert, desto unwichtiger wird sein Inhalt. Er verschwindet in der Masse. Und so wird es noch lange Zeit dauern, ehe die Geschichte vom Krieg der Sterne zu Ende erzählt ist. Bis dahin werden mehr Leute Obi-Wan Kenobi heißen, als es George Lucas sich je hat träumen lassen.
Quelle: Die Zeit 21/1999
JC



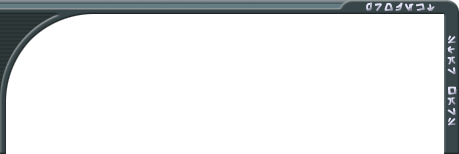
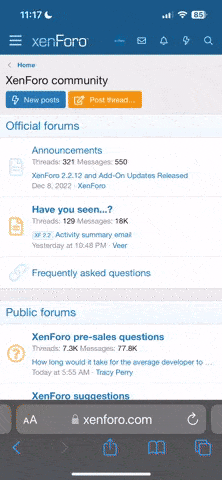


 betreut und von seiner Skywalker Ranch im nordkalifornischen San Rafael aus dem stetigen Wachstum seines Imperiums zugeschaut. Bis Anfang der neunziger Jahre war die Fortsetzung von Star Wars bloß eine vage Idee. Im Jahr 1994 begann Lucas, ein Drehbuch zu schreiben, das die Vorgeschichte der Ereignisse in den ersten drei Star Wars-Folgen erzählen sollte, die Geschichte von Luke Skywalkers Vater Anakin, aus dem später der böse Darth Vader wird, und seiner Frau, der Königin Amidala. Aber erst die Wiederbeschäftigung mit den früheren Filmen brachte, so scheint es, Lucas' Imagination in Gang.
betreut und von seiner Skywalker Ranch im nordkalifornischen San Rafael aus dem stetigen Wachstum seines Imperiums zugeschaut. Bis Anfang der neunziger Jahre war die Fortsetzung von Star Wars bloß eine vage Idee. Im Jahr 1994 begann Lucas, ein Drehbuch zu schreiben, das die Vorgeschichte der Ereignisse in den ersten drei Star Wars-Folgen erzählen sollte, die Geschichte von Luke Skywalkers Vater Anakin, aus dem später der böse Darth Vader wird, und seiner Frau, der Königin Amidala. Aber erst die Wiederbeschäftigung mit den früheren Filmen brachte, so scheint es, Lucas' Imagination in Gang.